Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit
Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit Woher kommen die Werke der Barmherzigkeit und warum sind es sieben?
Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit Woher kommen die Werke der Barmherzigkeit und warum sind es sieben?


Für Jesus ist die Barmherzigkeit Gottes an keine Vorleistung gebunden, wie er zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Vater (Lk 15,11–32) deutlich macht. Hat man selber aber an sich Barmherzigkeit erfahren, bleibt eigenes unbarmherziges Verhalten nicht folgenlos (siehe das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger: Mt 18,23–27). Folgerichtig hat der flämische Meister von Alkmaar um 1505 Christus in die Szenebilder der Sieben Werke der Barmherzigkeit gesetzt (siehe rechts ein Ausschnitt).
Jesus formuliert einen Katalog der Werke der Barmherzigkeit innerhalb einer Gerichtsrede, die in den Worten gipfelt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan … Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan“ (Mt 25,40.45).
Diesen sechs Werken – Hungrige speisen, Durstige tränken, Fremde und Obdachlose aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen, Gefangenen beistehen (Mt 25,35–36) – fügte der Kirchenschriftsteller Laktanz (gestorben 320) unter Rückgriff auf das Buch Tobit (1,17) das Begraben der Toten als siebtes Werk hinzu. Die klassische Siebenzahl verbindet die 3 als Zahl des in sich Geschlossenen, Absoluten, mit der 4 als Zahl der Ordnung und der Vollständigkeit. 4 + 3 steht somit für die Fülle und Vollkommenheit schlechthin, im Neuen Testament zuletzt durch die sieben Hörner und sieben Augen des Lammes, die seine Allmacht und Allwissenheit bedeuten (Offb 5,6).
Die Werke der Barmherzigkeit wurden zum einen konkret angewandt, zum anderen einer spirituellen Lesart unterworfen. So unterschied bereits der Kirchenvater Augustinus (gestorben 430) zwischen „Wohltaten am Leib des Nächsten“ und „Wohltaten an der Seele des Nächsten“. Im Mittelalter waren auch die geistigen oder geistlichen Werke der Barmherzigkeit in einem Siebenerkatalog kodifiziert: Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern verzeihen, Lästige ertragen, für Lebende und Verstorbene beten.

Hungrige speisen
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitHungrige speisen
Hungernde speisen Begegnung, Hilfe, Nähe „Es ist gut, dass Armen hier etwas zu Essen gegeben wird“, findet der junge Jonas aus Kaufbeuren. Deswegen unterstützte er die Wärmstube des sKM Kaufbeuren/Ostallgäu mit einer besonderen Idee. Sein Beispiel zeigt: Hungernde speisen – das kann jeder, egal, wie alt man ist.
Hungernde speisen Begegnung, Hilfe, Nähe „Es ist gut, dass Armen hier etwas zu Essen gegeben wird“, findet der junge Jonas aus Kaufbeuren. Deswegen unterstützte er die Wärmstube des sKM Kaufbeuren/Ostallgäu mit einer besonderen Idee. Sein Beispiel zeigt: Hungernde speisen – das kann jeder, egal, wie alt man ist.

Wie aus Büchern belegte Brote werden

„Es gibt arme Menschen, und denen kann man helfen. Wir sind dankbar, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und es uns gut geht“, erklärt Marion Habermeier die Lebenseinstellung, die sie und ihr Mann den drei Kindern Jonas, Lilly und Jacob vermitteln wollen. Bereits im Kindergarten hatte Jonas von der Wärmestube gehört. Der Grundschüler entschied sich nun, dazu eine Geschichte zu schreiben. Er erzählt darin den abenteuerlichen Schulalltag von „Mia“.
Alles sei frei erfunden, sagt Jonas. Seine Eltern kümmerten sich um die Vervielfältigung, zunächst in Handarbeit. Da die ersten Exemplare schnell Abnehmer fanden, die gerne eine Spende für die Wärmestube gaben, ließ die Familie auf eigene Kosten bei einer ortsansässigen Druckerei eine neue Auflage drucken.
Rund 500 Euro hat Jonas gesammelt und an die Leiterin der Wärmestube, Gabriele Boscariol, übergeben. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, macht Boscariol deutlich. Zu den Personalkosten der festangestellten Mitarbeiterinnen bekommt der Ortsverband des SKM (Katholischer Verband für soziale Dienste) zwar Zuschüsse von der Diözese und der Stadt. Die weiteren Personalausgaben sowie die Betriebskosten für das historische Gebäude in der Altstadt und die benötigten Lebensmittel, insgesamt rund 30 000 Euro jährlich, müssen jedoch aus Zuwendungen bestritten werden. Die Aktion des kleinen Jonas begeistert das Team und erfüllt es mit Dankbarkeit. „Es ist gut, dass Armen hier etwas zu Essen gegeben wird“, meint der Junge selbst: „Hauptsache, ihnen ist geholfen.“
Obdachlose und Bedürftige erhalten in der Wärmestube am Crescentiaplatz für ein paar Cent einen heißen Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk. Tee und belegte Brote werden kostenfrei verteilt. Rund 120 Stammgäste kommen regelmäßig. Etwa ab Mitte des Monats steigt die Zahl der Besucher deutlich an, beobachten die Helferinnen. Über 20 ehrenamtliche Mitarbeiter zwischen 25 und Anfang 70 Jahren engagieren sich in ihrer Freizeit unentgeltlich in der Wärmestube, in dem sie den Thekendienst übernehmen, also Kaffee und Tee kochen sowie Brötchen schmieren.
Stark zugenommen hat die Zahl der jungen Gäste zwischen 18 und 25 Jahren. Obdachlose können in der Einrichtung auch duschen und ihre Wäsche waschen. Darüber hinaus kommen die Menschen, um der Einsamkeit zu entfliehen. „Die Wärmestube ist wie mein Wohnzimmer, fast wie in einer Familie“, beschreibt es eine Obdachlose. Gleichzeitig ist es für viele Betroffene ein „geschützter Raum“, der bedeutet, für einige Stunden „weg von der Straße“ zu sein. „Hier sind liebe, nette Menschen, die einen so nehmen, wie man ist“, hebt ein 55-Jähriger hervor. Schon seit 18 Jahren geht ein 46-jähriger Kaufbeurer regelmäßig in die Wärmestube. Neben der Brotzeit schätzt er die Gespräche.
Anstatt in der Stadt „abzuhängen“, besucht eine 22-Jährige den Treff . Sie hat einen festen Wohnsitz, aber die finanziellen Mittel reichen oft kaum aus. Sie weiß, dass sie bei Bedarf das Angebot der ebenfalls im Haus ansässigen Fachberatungsstelle annehmen könnte. Die Sozialpädagoginnen unterstützen etwa bei Formularen
oder Behördenfragen.
Elke Sonja Simm/Katholische SonntagsZeitung

Durstigen zu trinken geben
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitDurstigen zu trinken geben
Durstigen zu trinken geben Brunnen für Bolivien In den entlegenen Bergdörfern Boliviens ist die Versorgung mit Trinkwasser ein großes Problem. Hanne Atzinger aus Wettenhausen ist schon oft dorthin gereist, um den Dorfbewohnern mit Rat und Tat beim Brunnenbau zur Seite zu stehen.
Durstigen zu trinken geben Brunnen für Bolivien In den entlegenen Bergdörfern Boliviens ist die Versorgung mit Trinkwasser ein großes Problem. Hanne Atzinger aus Wettenhausen ist schon oft dorthin gereist, um den Dorfbewohnern mit Rat und Tat beim Brunnenbau zur Seite zu stehen.

Auf der Suche nach der Quelle

Manche sind dort so arm und ausgehungert, dass sie die Menschen erst einmal mit Grundnahrungsmitteln versorgen muss, damit sie am Bau von Wasserleitungen mitarbeiten können. Dann sucht Hanne Atzinger nach einer Quelle. Ist sie gefunden, installiert ein Techniker – mit Unterstützung einiger Arbeiter aus dem jeweiligen Ort – eine Staustufe und eine Filterkammer.
Das Material dafür, zum Beispiel Stahlbeton, bestellt Hanne Atzinger in La Paz oder in Chile. Dann werden Rohre in die Berge getragen. Bis zu einem bestimmten Punkt können dabei Esel mithelfen.
Die Esel bestellt die Entwicklungshelferin bei Nachrichtenläufern in den Anden, die dort auch Ersatz für die Zeitung sind. Mal braucht sie 100 Esel, mal 50. Rund zwölf Kilometer müssen die Rohrträger zwischen dem Gebirge und dem Dorf zurücklegen. Aus jedem Haushalt arbeitet eine Person mit. Auch die Kinder, vor allem die zwölf- bis 14-jährigen Buben, helfen. Mit ihrem Techniker schult Hanne Atzinger Jugendliche in den technischen Prozessen in Verbindung mit der Wasserversorgung. Wenn das Trinkwasserprojekt abgeschlossen ist, findet ein Fest statt. Die Schulkinder stehen Spalier und begrüßen Hanne Atzinger. Dann tragen sie Gedichte vor und singen Lieder. Der Gemeindepräsident und der Schulleiter halten Dankesreden. Die Erwachsenen musizieren auf Trommeln, Flöten und zwölfsaitigen Gitarren. Aus ihrer Heimat gibt Hanne Atzinger Volkslieder wie „Kein schöner Land“ zum Besten. Dann segnet sie symbolisch einen Becher Wasser und alle beten das „Vaterunser“.
Bolivien ist flächenmäßig etwa viermal so groß wie Deutschland, hat aber nur ein Zehntel der Einwohnerzahl von Deutschland. Hanne Atzingers Verbundenheit mit Bolivien begann 1990. Damals leitete sie eine Seniorengruppe, die selbst gestrickte Babydecken nach Israel schickte.
Im gleichen Jahr ereignete sich in der Provinzstadt Camargo in Bolivien ein Erdrutsch, bei dem viele Menschen ums Leben kamen oder wohnungslos wurden. Also fragte eine Bekannte an, ob Hanne Atzingers Gruppe auch Decken nach Bolivien schicken könne. Über Schwester Goretti Hagg, die in Camargo das Krankenhaus der Armen leitete, entstand der Kontakt zu dem deutschen Pater Otto Strauss. Zu dessen Arbeit gehören auch Trinkwasserprojekte.
Hanne Atzinger ist in Franken geboren, wuchs aber im Internat der Dominikanerinnen in Wettenhausen auf. Die pensionierte Lehrerin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Neben den Trinkwasserprojekten ist sie auch in anderen sozialen Projekten in Bolivien engagiert. Manchmal bringt sie ausrangierte Trikots von schwäbischen Fußballvereinen mit nach Bolivien. Schließlich brauche jedes bolivianische Dorf eine Kapelle, eine Schule und einen Fußballplatz, weiß Pater Otto.
Martin Gah/Katholische Sonntagszeitung

Fremde aufnehmen
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitFremde beherbergen
Fremde beherbergen "Ich war fremd und obdachlos..." Hunderttausende Flüchtlinge aus Krisengebieten wie Syrien oder dem Irak sind allein in diesem Jahr nach Deutschland gekommen. Die meisten sprechen kein Wort Deutsch, fühlen sich fremd und isoliert. Es ist unsere Aufgabe, auf die neue Mitbürger zuzugehen und sie zu integrieren, meint Nicole Seibold, Pastoralreferentin in der Diözese Augsburg.
Fremde beherbergen "Ich war fremd und obdachlos..." Hunderttausende Flüchtlinge aus Krisengebieten wie Syrien oder dem Irak sind allein in diesem Jahr nach Deutschland gekommen. Die meisten sprechen kein Wort Deutsch, fühlen sich fremd und isoliert. Es ist unsere Aufgabe, auf die neue Mitbürger zuzugehen und sie zu integrieren, meint Nicole Seibold, Pastoralreferentin in der Diözese Augsburg.

Ehap ist mittendrin
Ich merke, wie schwer es mir fällt, ihn, sozusagen sprachlos, irgendwie in meinen Unterricht zu integrieren, ihn ein bisschen aus seiner Isolation herauszuholen. „Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben …“ Ehap hatte anfangs kein Pausenbrot dabei. Aber woher weiß ich, ob er Hunger hat und ob er überhaupt Brezen mag?
Jetzt, wo so viele Menschen in unser Land kommen, die schreckliche Erlebnisse aus einer für uns so fernen Welt mitbringen, wird dieses Evangelium zur Herausforderung, zum Auftrag. Das wird mir täglich mehr bewusst. Obwohl ich mich, wie ich meine, zumindest bemühe, ein Leben aus dem Evangelium zu führen, spüre ich eine große Hilflosigkeit, finde mich eher auf der Seite derer wider, die Jesus nicht geholfen haben.
Vielleicht geht es Ihnen auch so – es fehlt einfach der Mut, die Scheu zu überwinden und einfach mal hinzugehen zum Haus der Asylbewerber, obwohl man sich nicht verständigen kann und nicht weiß, was einen dort erwartet. Lieber überlässt man diese Dinge doch irgendwelchen Zuständigen, die es hoffentlich irgendwo gibt. Und wenn doch nicht?
Gelernt habe ich bis jetzt viel von den Kindern, den Mitschülern von Ehap. Die haben nämlich gar keine Angst oder Scheu. Die gehen einfach hin: „Ehap, essen?“, und machen ihm mit eindeutigen Gesten klar, was sie ihm sagen wollen. Und Ehap versteht. Nicht immer, aber immer öfter. Ein paar Worte kann der kleine Syrer jetzt auch schon selber sagen. Und er ist mittendrin in ihrer Gemeinschaft. Er gehört einfach dazu, weil er jetzt halt da ist. Ohne dass einer groß darüber nachdenkt.
Nachdenklich macht mich die Empörung mancher Erwachsener darüber, dass Turnhalle und Schullandheim für diesen Winter Asylbewerbern überlassen werden und nicht für Sport und Freizeit zur Verfügung stehen. Früher, so erzählten uns die Großeltern, musste jede Familie, die ein Zimmer frei hatte, Flüchtlinge in ihr Haus aufnehmen, mit ihnen Küche und Bad teilen.
Manchmal versuche ich mir vorzustellen, was wäre, wenn es heute wieder so weit wäre, dass wir Flüchtlinge in unser Haus aufnehmen müssten. Ich hoff e und bete darum, dass wir unsere Tür weit aufmachen würden, um Christus in diesen Fremden aufzunehmen.
Nicole Seibold/Katholische SonntagsZeitung
Nackte bekleiden
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitNackte bekleiden
Nackte bekleiden Wie Sankt Martin Weil er dem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte, ist Sankt Martin auch für viele Kinder ein Vorbild. Bei der Aktion „Meins wird deins“ tun es Kinder im Bistum Augsburg dem Heiligen gleich und spenden Kleider, die sie nicht mehr brauchen.
Nackte bekleiden Wie Sankt Martin Weil er dem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte, ist Sankt Martin auch für viele Kinder ein Vorbild. Bei der Aktion „Meins wird deins“ tun es Kinder im Bistum Augsburg dem Heiligen gleich und spenden Kleider, die sie nicht mehr brauchen.

"Meins wird deins"

Die Kleidersammel-Aktion der Aktion Hoffnung und des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ mit dem Untertitel „Jeder kann St. Martin sein“ fand 2015 zum 13. Mal statt. Sie ruft Kinder und Erwachsene auf, dem Beispiel des heiligen Martin zu folgen und abzugeben, was andere brauchen können. Allerdings werden die Sachen nicht verschickt. Sie kommen in die Vintys-Secondhand-Geschäfte und Fair-Trade-Läden der Aktion Hoffnung in Augsburg, Erlangen, Ettringen, München, Nürnberg und Passau.
Die Erlöse aus dem Verkauf und die Geldspenden fließen einem Projekt in El Alto in Bolivien zu. „Im Kindergarten der Stiftung werden Kinder aus indigenen Familien pädagogisch gefördert und auf die Schule vorbereitet, mit kreativen und spielerischen Angeboten wird das sprachliche Verständnis verbessert“, stellt Gregor Uhl, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, dar. Die Stiftung betreibt zwei weitere Zentren, die von 215 Kindern und Jugendlichen besucht werden und leistet Sozialarbeit.
Pfarrer Ulrich Lindl, Leiter der Hauptabteilung III – Kirchliches Leben, ruft dazu auf, die Kultur des Teilens mit den Kindern neu zu entdecken. Angesichts der momentanen Flüchtlingsströme weist er darauf hin, dass die meisten Menschen durch Landflucht ihre Heimat verlassen. „Auch in Bolivien zieht es viele Landbewohner in die Hauptstadt“, erklärt er. Weil die Mieten dort sehr hoch sind, entsteht eine Stadt vor der Stadt, in der die meisten Kinder sich selbst überlassen sind und ein Drittel keine Schule besucht.
Im katholischen Kindergarten St. Thomas Morus in Neusäß wird das den Kindern nahegebracht. „Wir führen die Aktion Meins wird Deins seit vier Jahren in der Krippe, im Kindergarten und im Hort durch und gestalten sie unterschiedlich entsprechend dem Alter der Kinder“, berichtet die Leiterin Stefanie Rusch. Die kleinen Spender dürfen zu ihrem Kleidungsstück eine Geschichte erzählen. Dann werden gemeinsam die Kartons gepackt. Arbeitsmaterialien für Schulen und Tagesstätten stehen zum Herunterladen auf der Internetseite www.aktion-hoffnung.de, Prospekte und Plakate können bestellt werden.
Die Kleiderkartons werden in allen Secondhand-Läden und im Eine-Welt-Zentrum der Aktion Hoffnung in Ettringen entgegen genommen. Wer keine Möglichkeit hat, den Postversand nach Ettringen zu finanzieren, kann im Internet einen kostenlosen Paketschein erstellen. Viele Gruppen lassen sich die Kosten von Eltern und Großeltern sponsern oder organisieren Aktionen, mit deren Ertrag das Porto gezahlt wird.
„Die Erlöse gehen komplett an das Projekt in Bolivien“, betont Gregor Uhl. Im letzten Jahr wurden mit 19 570 Euro Schulen auf den Philippinen unterstützt, damit die Kinder eine regelmäßige und gesunde Mahlzeit bekommen können.
Roswitha Mitulla/Katholische SonntagsZeitung

Kranke pflegen
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitKranke pflegen
Kranke besuchen Rastlose Arbeiterin für die Liebe Alles begann 1960, als Ruth Pfau in Pakistan zufällig eine Kolonie von Leprakranken besuchte. Die deutsche Ordensschwester war tief beeindruckt vom schlimmen Schicksal der Ausgestoßenen. Der Kampf gegen die tödliche Krankheit Lepra sollte zu ihrem Lebenswerk werden.
Kranke besuchen Rastlose Arbeiterin für die Liebe Alles begann 1960, als Ruth Pfau in Pakistan zufällig eine Kolonie von Leprakranken besuchte. Die deutsche Ordensschwester war tief beeindruckt vom schlimmen Schicksal der Ausgestoßenen. Der Kampf gegen die tödliche Krankheit Lepra sollte zu ihrem Lebenswerk werden.

In einer Leprakolonie fand Ruth Pfau ihre Berufung

Das war 1960. Die Lepra, dieser Fluch, der über den Menschen zu liegen schien, ist heute unter Kontrolle. Es ist das Lebenswerk dieser Deutschen, die Pakistan zur Ehrenbürgerin machte. Sie ist nicht nur eine den Ärmsten der Armen zugewandte Ärztin. Sie ist auch Gesundheitsmanagerin und charismatische Lehrerin, Intellektuelle und Mystikerin, Menschenrechtlerin, engagiert im Dialog mit den Muslimen und als überzeugte Pazifistin in der Friedensarbeit, für die sie höchste internationale Auszeichnungen erhielt, unter anderem den Magsaysay-Award, den „asiatischen Friedensnobelpreis“.
Schier unglaublich: Als katholische Nonne der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Mariä war sie im Rang einer Gesundheitsstaatssekretärin der Zentralregierung. Als afghanische Flüchtlinge über die Grenze im Norden die Lepra wieder ins Land brachten, baute sie im Untergrund in dem von Russen besetzten Land einen Gesundheitsdienst auf. Heute unterstützt Ruth Pfau pakistanweit die Hilfe für Schwerstbehinderte. Die Leitung des von ihr gegründeten Krankenhauses „Marie Adelaide Leprosy Centre“ (MALC) hat sie im vergangenen Jahr abgegeben. Nun kümmert sie sich landesweit um Behinderte.
In der Außenstation des MALC in Malir, einem Stadtteil von Karachi, hat Pfau ein neues Projekt ins Leben gerufen. Das Team besucht Schwerstbehinderte in den Slums, Menschen mit fortschreitender Muskellähmung, um die sich sonst niemand kümmert. Ruth Pfau hält derweil Sprechstunde. Nach kurzer Zeit ist der Raum voll: Eine demente Alte, die sie seit Jahren als Leprapatientin kennt, der sie Zeit und Zuwendung schenkt. Eine Mutter mit ihrem schwerstbehinderten Kind. Der Strom reißt nicht ab. Dazwischen zwei ausgeheilte Leprakranke. Sie zeigen ihr die Wunden an verkrüppelten Füßen. Sie haben nicht die richtigen Schuhe. Das lässt Pfau keine Ruhe. „Hat man denn schon Kontakt mit einem Schuster aufgenommen?“, fragt sie den verantwortlichen Leiter. Ja, aber das hätte nicht geklappt. Sie ist unzufrieden, fragt nach. Man sieht, wie es in ihr arbeitet.
Gefragt, ob dies alles nicht ein Tropfen auf den heißen Stein sie, stimmt sie zu. Sie hat auch keine Antwort auf das Leiden. „Vielleicht ist es unsinnig, etwas zu tun. Aber nichts zu tun“, sagt sie, wäre noch unsinniger.“ Also macht sie weiter. Trotz ihres Alters, trotz aller Gebrechen, die auch sie kennt.
Wenn sie nicht wirklich überzeugt wäre, dass Liebe das letzte Wort ist, trotz allen Augenscheins, sagt Ruth Pfau, dann stünde ihr eigenes Leben auf dem Spiel. Denn dann hätte alles keinen Sinn. „Vielleicht täusche ich mich“, fügt sie hinzu. Und wenn dem wirklich so wäre? „Dann habe ich eben Pech gehabt.“ Und sie fragt zurück: „Wäre damit auch die Liebe sinnlos? Nein! Auch nicht das Mitgefühl, das uns verbindet. Und auch nicht die kleinen Gesten, selbst wenn sie nichts bewirken, nicht die Hilfe, die wir einander gewährt haben, um das Leben ertragbarer zu machen.“ Und die lapidare Schlussfolgerung dieser erstaunlichen Frau: „Deshalb mache ich weiter.“
Zurück im MALC geht Pfau noch einmal auf Salam zu, den für Groß-Karachi zuständigen Leprosy Field Offi cer: Wie er das mit den Sanitärschuhen regeln wird? Wie wäre es, wenn sie in der Außenstation dauerhaft mit einem Schuster kooperieren würden? Ob sie jetzt gleich einen Termin machen können, um eine Lösung zu finden? Er ist die nächsten Wochen weg! Aber gleich am Montag nach seiner Rückkehr? Etwas genervt zückt Salam seinen Terminkalender, nickt. Man muss auch nerven können. Nicht nur der Teufel, auch der liebe Gott steckt im Detail. Und es wird eine Lösung geben. Damit für einige das Leben leichter und erträglicher wird. Es gibt einen bekannten Spruch: „Einen Mystiker erkennt man daran, wie er seine Schuhe bindet.“ Das heißt: wie er sich im Alltag und in ganz unscheinbaren Dingen verhält. Vielleicht könnte man diesen Spruch auch abwandeln: Einen wahren Mystiker erkennt man auch daran, dass er spürt, wo andere der Schuh drückt. Und daran, dass er hilft.
Rudolf Walter/Katholische SonntagsZeitung

Gefangene besuchen
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitGefangene besuchen
Sich um Gefangene sorgen Schlüssel zu versperrten Türen Manche Menschen kommen vom rechten Weg ab, landen vor Gericht und hinter Gittern. Dieser Mann ist für die Verurteilten da, spricht mit ihnen über ihre Ängste und Sorgen: Pastoralreferent Michael Barnt betreut Gefangene in den Justizvollzugsanstalten Augsburg und Niederschönenfeld.
Sich um Gefangene sorgen Schlüssel zu versperrten Türen Manche Menschen kommen vom rechten Weg ab, landen vor Gericht und hinter Gittern. Dieser Mann ist für die Verurteilten da, spricht mit ihnen über ihre Ängste und Sorgen: Pastoralreferent Michael Barnt betreut Gefangene in den Justizvollzugsanstalten Augsburg und Niederschönenfeld.

Ein Gefängnisseelsorger im Interview

Geboren vor 50 Jahren in Radeberg, wuchs ich in der Diaspora auf und fand von klein auf in der Kirche eine Heimat. In der Schule war ich der einzige Katholik und musste mich den Anfragen meiner Schulkameraden stellen. Das brachte mich zur intensiveren Beschäftigung mit dem Glauben und führte mich später nach Erfurt, wo ich Theologie studierte. Nach dem Abschluss des Studiums ging ich ein Jahr nach Jerusalem, um das Gelernte vor Ort, das heißt an biblischen Stätten, zu vertiefen. Dort lernte ich auch meine Frau kennen, die mich nach Augsburg brachte. Hier machte ich zunächst eine Ausbildung zum Schreiner, bevor ich, nunmehr vor über zehn Jahren, wieder in den Gemeindedienst ging.
Was gab den Ausschlag, dass Sie Seelsorger geworden sind?
Bereits im Studium beschäftigte ich mich mit existentiellen Fragen der Menschen und den Möglichkeiten, darauf eine Antwort zu finden. Damals war es Viktor E. Frankl, der mit seiner Logotherapie mein Interesse weckte. Aber ebenso entscheidend waren die Begegnungen mit verschiedenen Menschen, seien es die unbekannten, die still Tag für Tag so leben, wie es Gott gefällt, oder auch die Begegnung mit dem Jesuitenpater Hugo E. Lassalle, der fernöstliche Methoden der Meditation für uns Christen bekannt gemacht hat. Und dann hat sicher auch die Stimme des eigenen Herzens den Ausschlag gegeben, oder, wenn Sie so wollen, nennen Sie es Berufung.
Warum haben Sie sich entschlossen, Seelsorger in einer Justizvollzugsanstalt zu werden?
Nach über zehn Jahren Tätigkeit in der Jugendarbeit und in verschiedenen Pfarrgemeinden beziehungsweise Pfarreiengemeinschaften war es mein Wunsch, noch einmal etwas Neues zu wagen. Dass ich in einem Gefängnis „landen“ würde, hätte ich auch nicht vermutet. Aber ich nehme diese Herausforderung gern an und merke, dass hier Seelsorger gebraucht werden. Ich bin sowohl in der JVA Augsburg als auch in der JVA Niederschönenfeld wohlwollend aufgenommen worden.
Wie reagieren die Gefangenen, wenn Sie auf sie zugehen, wenn Sie sie ansprechen?
Zunächst ist das mit dem Ansprechen gar nicht so einfach, denn im Moment muss ich selbst erst einmal lernen, welcher Schlüssel welche Türe aufsperrt, und dann gibt es auch Gefangene, die kaum Deutsch sprechen. Aber wenn diese Hürden genommen sind, sind die meisten Gefangenen sehr dankbar, dass es da noch jemanden gibt, mit dem sie über alles reden können.
Können Sie schon über negative oder positive Erlebnisse bei der Gefangenenbetreuung berichten?
Am Anfang meines Dienstes begleitete ich Pater Stephan mit meiner Gitarre zum Gottesdienst ins Gefängnis. Ich war gespannt, was mich erwarten würde. Als dann die Gefangenen alle in die Kirche einrückten, war ich völlig überrascht, wie viele hier am Gottesdienst teilnahmen. Gut, dachte ich, nicht jeder von denen hat dafür tiefe religiöse Gründe. Aber ein paar Tage später war ich doch überrascht, als ich mit einem Gefangenen ins Gespräch kam und er mir erzählte, dass er beim Gottesdienst Ruhe und Besinnung finde.
Interview: Manfred Arloth/Katholische SonntagsZeitung

Tote in Würde verabschieden
Die leiblichen Werke der BarmherzigkeitTote in Würde verabschieden
Tote in Würde verabschieden Im Glauben an die Auferstehung Vom traditionellen Erdbegräbnis bis zur Feuerbestattung in Wäldern, auf hoher See oder gar im Weltraum: Die Bestattungskultur wird immer vielfältiger. Liturgiewissenschaftler Winfried Haunerland, Berater der Kommission für liturgische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, erklärt, wie die Möglichkeiten der Beisetzung aus kirchlicher Sicht zu bewerten sind.
Tote in Würde verabschieden Im Glauben an die Auferstehung Vom traditionellen Erdbegräbnis bis zur Feuerbestattung in Wäldern, auf hoher See oder gar im Weltraum: Die Bestattungskultur wird immer vielfältiger. Liturgiewissenschaftler Winfried Haunerland, Berater der Kommission für liturgische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, erklärt, wie die Möglichkeiten der Beisetzung aus kirchlicher Sicht zu bewerten sind.

Würde über den Tod hinaus
Das Verhältnis zur Kremation hat sich stark gewandelt. Antireligiöse Haltungen und ideologische Beweggründe, die im 19. Jahrhundert eine große Rolle spielten, sind heute nicht mehr ausschlaggebend. Weil anfangs die Feuerbestattung als Bekenntnis verstanden wurde, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, hatte die Kirche erhebliche Vorbehalte und verbot den Katholiken bis in die 1960er Jahre die Kremation. Inzwischen sind jedoch die Gründe, weshalb sich Menschen für eine Einäscherung und damit gegen die klassische Erdbestattung entscheiden, nicht mehr per se unchristlich oder antikirchlich, sondern ausgesprochen vielfältig.
Wie erklären Sie sich diesen Umbruch?
Ein wichtiger Punkt ist, dass eine Urnenbestattung günstiger ist. Eine Begräbnisstätte für eine Urne kostet zumeist nicht so viel wie ein Grab, in dem ein ganzer Sarg Platz haben muss. Zudem wächst die Sorge, ob Angehörige da sind, die auf Dauer ein großes Grab pflegen werden. Eine Urnenbestattung gilt oftmals als die einfachere, sparsamere oder pflegeleichtere Form der Beisetzung und wird inzwischen von manchen ernsthaft in Betracht gezogen, die früher ganz erhebliche Bedenken hatten. Viele neue, individuelle und alternative Bestattungsformen setzen ebenfalls die Kremation voraus.
Das heißt, die Kremation bietet im Gegensatz zur Erdbestattung neue Möglichkeiten der Bestattung?
Die Asche kann nicht nur in einem Urnengrab auf dem Friedhof beigesetzt werden, sondern auch in einem Kolumbarium oder einer Grabeskirche. Die Seebestattung, das Verstreuen der Asche in den Bergen, die Bestattung in der Nähe des Lieblings-Fußballvereins oder die mitunter anonyme Bestattung in Friedwäldern und Ruheforsten, aber auch die eher exotischen Formen der Umschmelzung der Asche in einen Diamanten oder der Raumfahrtbestattung, bei ein Teil der Asche in die Atmosphäre gesandt wird, setzen die Kremation voraus.
Welchen Einfluss haben die Art der Bestattung und Form Beisetzung auf das Totengedenken?
Die Erdbestattung ist eine große Hilfe, den Verstorbenen auf seinem letzten Weg zu begleiten und Abschied zu nehmen. Mit einem Grab auf dem Friedhof hat man einen klaren Ort der Trauer, der nicht direkt bei den Lebenden ist, aber doch die Möglichkeit bietet, die Distanz immer wieder zu überwinden, um die Erinnerung an einem bestimmten Ort wach zu halten.
Die Konsequenzen, die sich aus den anderen Formen auf Trauerarbeit, Trauerkultur und Trauererleben im Einzelfall ergeben, sind sicher sehr individuell. Es gibt Menschen, die darunter leiden, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie trauern können, etwa weil eine Beisetzung anonym stattgefunden hat oder die Asche auf See beigesetzt wurde. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht als einen Mangel erleben.
Schon jetzt gibt es Gräber, die einen sogenannten QR-Code haben, der zu Trauerseiten im Internet verlinkt, die an den Verstorbenen erinnern sollen. Digitale Bestattungen, digitale Gräber im Internet – wird das zunehmend ein Thema sein?
Wie Zeitungen einmal begonnen haben, auch individuelle Nachrichtenträger zu werden und Todesanzeigen zu veröffentlichen, wird es selbstverständlicher, dass Todesanzeigen bewusst ins Internet gesetzt werden. Vielleicht wird das Netz in Zukunft verstärkt dort genutzt werden, wo klassische Formen den Trauernden faktisch nicht mehr zur Verfügung stehen.
Schon heute greifen die Trauer- und Gedenkseiten im Netz vieles von dem auf, was in der realen Welt eigentlich in einer Kirche oder auf dem Friedhof seinen Platz hat, wie die virtuellen Trauerbücher und das virtuelle Entzünden von Kerzen zeigen. Insofern wird die digitale Welt die bestehende Erinnerungskultur ergänzen. Aber sie wird sie nicht ablösen oder ersetzen, denn im Netz wird der Leichnam nicht wirklich bestattet. Deshalb wird das reale Begräbnis nach meiner Auffassung immer ein großes Stück von der digitalen Welt getrennt sein.
„Ein Volk wird so beurteilt, wie es seine Toten bestattet“, lautet ein Sprichwort, das dem altgriechischen Staatsmann Perikles zugesprochen wird. Was sagt der Umbruch in der Bestattungskultur über die Gesellschaft?
Die Ehrfurcht und Sorgfalt, die Menschen ihren Verstorbenen erweisen, zeigen, welchen Wert der einzelne Mensch hat und mit welcher Achtung man ihm begegnet. Mangelnde Wertschätzung des Menschen lässt sich heute aber sicher nicht an der Verbrennung festmachen, denn auch Kremationen und viele der damit zusammenhängenden Beisetzungsmöglichkeiten können sehr würdevoll sein.
Weit mehr Sorge bereitet, wenn die anonyme Bestattung gewählt oder beim Begräbnis auf jede öffentliche Verabschiedung und Ritualisierung verzichtet wird, weil der Leichnam des Verstorbenen nur noch als „sterblicher Überrest“ angesehen wird, der entsorgt werden muss. Jeder Mensch hat eine Würde, die die Lebenden über den Tod hinaus in die Pflicht nimmt. Auch wer nicht an ein ewiges Leben glaubt, sollte dem Leib Respekt zeigen und die bleibende Würde des Menschen auch nach dessen Tod achten.
Welches ist die zentrale Herausforderung des Wandels? Und wie sollte man ihm begegnen?
Die zentrale Herausforderung ist weniger die Frage nach den Bestattungsformen, sondern die Frage, wie wir mit dem Lebensende umgehen und mit der Tatsache, dass wir Menschen sterben müssen. Wird der Tod verdrängt und müssen Tote möglichst schnell entsorgt werden oder gelingt es wieder mehr, das Sterben, den Tod und damit auch die Toten als Teil unseres Lebens wahrzunehmen? Dazu gehört auch, sich Zeit zu nehmen und sich bewusst von den Verstorbenen zu verabschieden. So können wir lernen, dass der Tod und das Sterben zu unserem Leben gehören.
Wie geht die Kirche mit den vielen neuen Bestattungsformen um?
Es kommt nicht so sehr auf die Bestattungsform an, sondern vielmehr auf die Frage, aus welchen Motiven sie gewählt wird. Mir fällt keine Beisetzungsform ein, die ein kirchliches Begräbnis grundsätzlich unmöglich erscheinen lässt. Wichtig ist vielmehr, dass die Gründe für die Wahl mit dem Evangelium und dem kirchlichen Verständnis von einem Begräbnis vereinbar sind.
Entscheidet man sich bewusst für die Feuerbestattung, weil man nicht an ein ewiges Leben glaubt, ist das mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Ein katholisches Begräbnis wäre dann nicht möglich. Wird die Beisetzung in einem naturbelassenen Friedwald oder Ruheforst am Fuß eines Baumes gewünscht, um dadurch eine pantheistisch-naturreligiöse Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, kann sich die Kirche daran nicht beteiligen. Denn die Annahme, dass der Mensch in den Kreislauf der Natur übergeht und vielleicht auch noch in dem Baum, der über ihm blüht, wiederkehrt, steht im Widerspruch zum christlichen Glauben.
Wird diese Form der Bestattung aber gewählt, weil der Verstorbene jemand war, der die Natur als Teil der Schöpfung Gottes wahrgenommen und als einen Ort großer Gottesnähe empfunden hat, verstößt die Beisetzung im Friedwald nicht zwangsläufig gegen den christlichen Auferstehungsglauben. Gleiches gilt für die Seebestattung: Wird sie gewollt, weil die See für den Verstorbenen das Sinnbild für ein Leben in Fülle mit Gott war, gibt es aus kirchlicher Sicht keinen Grund, ein katholisches Begräbnis zu verweigern.
Was ist aus kirchlicher Sicht bei einer Beerdigung entscheidend?
Das Wichtigste ist, dass der Verstorbene im Glauben an die Auferstehung bestattet wird. Wenn davon Abstriche gemacht werden müssten, ist keine katholische Beerdigung gewünscht, sondern eher eine Trauerfeier säkularen Typs. Ein solcher Wunsch ist legitim, aber die Kirche ist dafür nicht der richtige Ansprechpartner. Das kirchliche Begräbnis will Zeugnis geben vom Glauben an Tod und Auferstehung angesichts eines Verstorbenen, von dem wir glauben, dass er durch die Taufe zu Jesus Christus gehört und nicht nur mit ihm gestorben ist, sondern auch mit ihm auferstehen wird.
Das ist das Zentrum einer katholischen Beerdigung – mit dem Höhepunkt der Feier der Messe, die zum Ausdruck bringt, dass der, der als Lebender zur Gemeinschaft der Kirche gehört hat, auch im Tod von dieser Gemeinschaft nicht getrennt ist. Die Aufgabe der Kirche ist dabei nicht, über das Leben des Verstorbenen ein Urteil zu fällen – das ist allein Gottes Sache. Ihre Aufgabe ist es, das Glaubens- und Lebenszeugnis des Verstorbenen in Erinnerung zu rufen und ihn durch ihre Bitten und Gebeten über den Tod hinaus zu begleiten.
Interview: cs/Katholische SonntagsZeitung
Impressum
Impressum
Gesellschafter: Diözese Augsburg (100 %)
Geschäftsführer: Johann Buchart
Henisiusstraße 1, 86152 Augsburg
Postfach 11 19 20, 86044 Augsburg
Telefon: 0821/50242-0 (Zentrale)
Telefax: 0821/50242-41
E-Mail: johann.buchart@sankt-ulrich-verlag.de
HRB 6161, Amtsgericht Augsburg
Ust.IdNr. DE127510854
Videobeiträge von katholisch1.tv
Audiobeiträge von radioaugsburg.de
Textbeiträge: Katholische SonntagsZeitung/Neue Bildpost
Bildnachweis: Archiv Atzinger; Arloth; Eva K., Lizenz: Creative Commons Eva K., Lizenz: Creative Commons by-sa-2.5-generic (St. Martin);by-sa-2.5-generic (St. Martin); fotolia.com (13); Gah; gemeinfrei (Friedhof); Herder Verlag (2); Mitulla; Simm (2); Zugroaster, Lizenz Creative Commons by-sa-4.0 (Türschloss)
























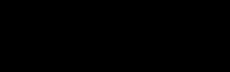



















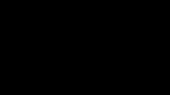
 Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit
Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit
 Hungrige speisen
Hungrige speisen
 Begegnung, Hilfe, Nähe
Begegnung, Hilfe, Nähe
 Durstigen zu trinken geben
Durstigen zu trinken geben
 Brunnen für Bolivien
Brunnen für Bolivien
 Fremde beherbergen
Fremde beherbergen
 "Ich war fremd und obdachlos..."
"Ich war fremd und obdachlos..."
 Tea Time
Tea Time
 Nackte bekleiden
Nackte bekleiden
 Wie Sankt Martin
Wie Sankt Martin
 Neue Menschen, neue Kleider
Neue Menschen, neue Kleider
 Kranke pflegen
Kranke pflegen
 Rastlose Arbeiterin für die Liebe
Rastlose Arbeiterin für die Liebe
 Leben und Tod
Leben und Tod
 Gefangene besuchen
Gefangene besuchen
 Schlüssel zu versperrten Türen
Schlüssel zu versperrten Türen
 Tote in Würde verabschieden
Tote in Würde verabschieden
 Im Glauben an die Auferstehung
Im Glauben an die Auferstehung
 Spiegelbild der Gesellschaft
Spiegelbild der Gesellschaft
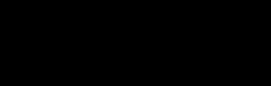 Impressum
Impressum